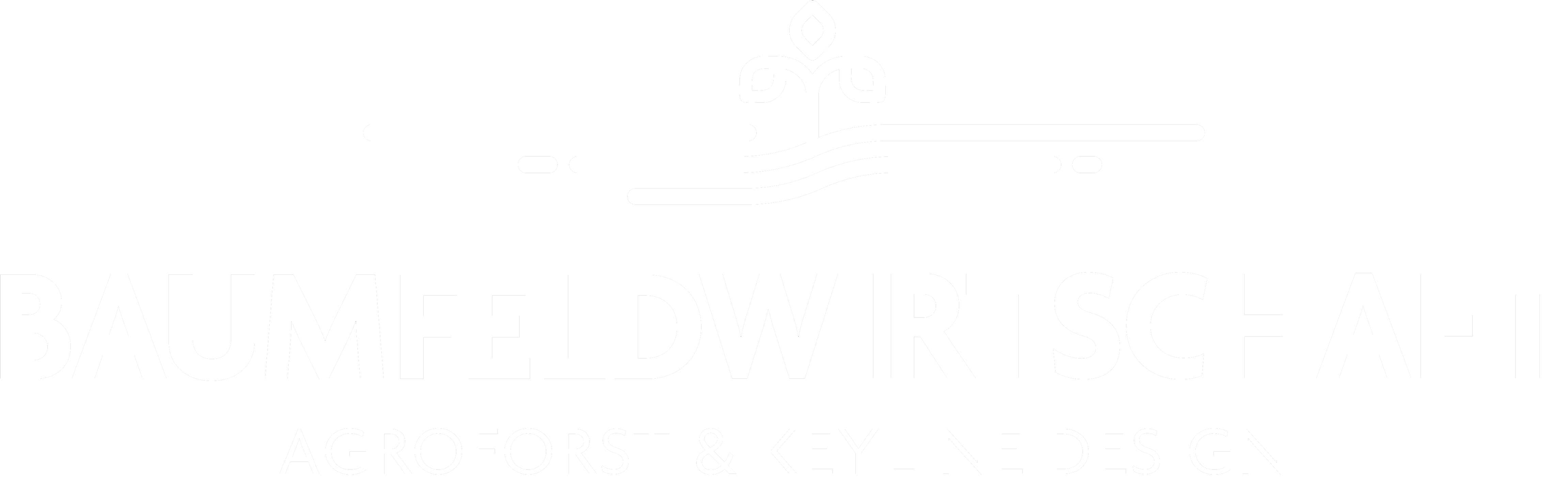Keyline Design: Wasser in den Flächen halten & lenken.
Was ist Keyline Design?

Keyline Design bringt Wasser dorthin, wo es gebraucht wird, denn wir müssen die Niederschläge, die wir haben, bestmöglich nutzen können. So sind große Einsparungen bei der Bewässerung in der Landwirtschaft möglich und die Gesundheit sowie das Ertragspotential des Bodens steigen.
Keyline Design ist die modernisierte Form einer altbewährten Technik, nach der ein System von Sammelgräben mit genau festgelegtem Gefälle angelegt wird. So wird Wasser effektiv verteilt und gespeichert. Diese “Schlüssellinienkultur” kann auf einem ganzen Betrieb oder auch auf einzelnen Schlägen angewendet werden. Dazu arbeiten wir mit hochauflösenden digitalen Geländemodellen und präziser Vermessungstechnik.
Keyline Planung
Wir setzen auf gründliche Planung, um das für den jeweiligen Betrieb geeignete System zu etablieren. Vor der Umsetzung eines Keyline Designs analysieren wir deshalb zu nächst das Gelände anhand seiner Geomorphologie, um zu verstehen, wie sich Wasser in ihm bewegt und verteilt. Auf dieser Grundlage können unter anderem Bearbeitungs- und Pflanzmuster erstellt werden, die sowohl Oberflächen- als auch Bodenwasser entlang der Geländekontur leiten können, so dass es besser aufgenommen, verteilt und gespeichert werden kann. Die Kombination von Keylines mit Gehölzstrukturen, wie z.B. Agroforst, trägt zusätzlich erheblich zur Wasserspeicherkapazität der Flächen bei.
Die Anlage von Keyline Systemen

In der Anlage der Keylinesysteme setzen wir auf das, was für den jeweiligen Betrieb sinnvoll und in der Bewirtschaftung möglich ist. Die Anlage der Systeme erfolgt durch Bagger, Pflug oder weitere Maschinen.
Von simplen Systemen, die lediglich Niederschlag effektiver an Ort und Stelle versickern, bis hin zu komplexen Wassersteuerungs- und Ablaufsystemen bieten wir eine große Bandbreite an Keyline Umsetzungen für jegliche Betriebsgröße und -ausrichtung an. Wir arbeiten in ganz Europa, haben aber den Hauptteil unserer Erfahrung in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesammelt.
Warum ist Keyline auch für Akteure außerhalb der Landwirtschaft relevant?
Keyline Design hält Niederschläge in der Fläche und dieses lokal versickerte Wasser (sowie der wertvollste Teil des Bodens) landet nicht im nächsten Bach oder den Kellern des Dorfes. Die Vorbeugung von Fluten und Schlammlawinen gewinnt drastisch an Wichtigkeit in den jetzigen Zeiten und fängt auf dem Acker an. Wenn Keylines und Gehölzstrukturen großflächig in einer Region umgesetzt werden, ergeben sich nachweislich Abkühlungseffekte und eine höhere Niederschlagswahrscheinlichkeit, da der latente Wärmefluss zunimmt, es zu verstärkter Turbulenz kommt und somit mehr Wasserdampf an die Atmosphäre abgegeben wird. Keyline Design bedeutet also Dürreprävention und Ertragssicherung für die Landnutzenden, sowie Hochwasserschutz und Klimaanpassung für die Region. Zu diesen Themen bieten wir auch Vorträge und Infoveranstaltungen an.